
Blog
Sie wollen sich vorab über mehrsprachige Erziehung informieren?
In Der Standard erscheinen regelmäßig unsere Blogbeiträge zum Thema gelebte Mehrsprachigkeit.
Sie finden auch Portraits von Menschen, die Mehrsprachigkeit besonders fördern!
In den Workshops und der Einzelberatung gehen wir auf häufig gestellte Fragen von Eltern und Pädagog*innen ein und bieten hilfreiche Antworten und Erklärungen.
Dies ist der aktuellste Blogbeitrag:
"Sprachgebote und Sprachverbote und ihre verheerenden Folgen"
Alle Sprachen sind wertvoll und wert, gesprochen zu werden. Wir sollten Kinder zu der Anwendung einer Sprache motivieren und nicht zwingen
Mag.a Zwetelina Ortega, Tina Cakara
1. Dezember 2023
Im Gastblog erklären Zwetelina Ortega und Tina Cakara, warum Mehrsprachigkeit gefördert - und nicht unterbunden - werden sollte.
Die Politik versucht immer wieder, an Österreichs Schulen eine Deutschpflicht am Pausenhof einzuführen und andere Erstsprachen der Kinder zu verbieten, wie zum Beispiel die FPÖ in Niederösterreich Anfang dieses Jahres, oder in Oberösterreich 2018, eine Forderung, die der damalige Bildungsminister ablehnte. Dies soll Parallelgesellschaften unter den Schüler:innen verhindern, den Deutscherwerb ankurbeln und die Integration fördern. In der Realität führt das aber oft zum Gegenteil. Kinder werden verunsichert, verstummen und ziehen sich zurück.
Wenn Sprachen verboten werden
An Österreichs Schulen ist die Mehrsprachigkeit der Kinder schon lange gelebter Alltag. Je nach Ort und Schultyp bringen manchmal bis zu 90 Prozent der Schüler:innen eine andere Erstsprachen als Deutsch oder neben Deutsch eine weitere Sprache mit. Die Erstsprache ist dabei für die Kinder nicht nur Kommunikationsvehikel, sondern zugleich das andere Standbein ihrer mehrschichtigen Identität, ihrerseits authentisches Ausdrucksmittel ihrer Gefühlswelt und unverzichtbares Band zu ihrer Familie und deren Herkunftskultur.
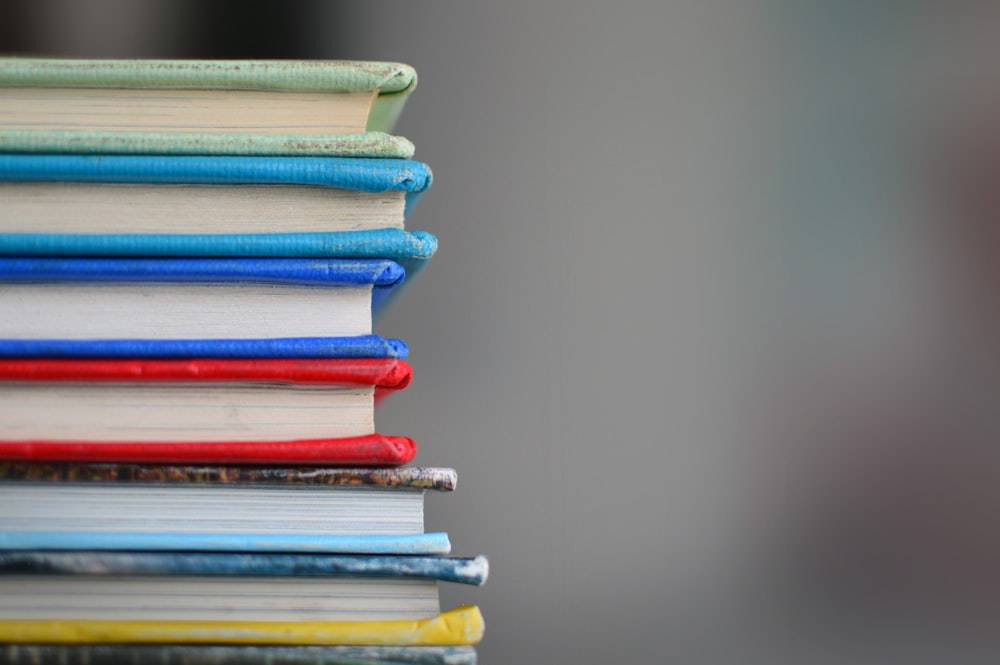
Wird Kindern der Gebrauch ihrer Erstsprache(n) in der Schule und sogar in den Pausen verboten, so hat dies negative Auswirkungen auf ihre Persönlichkeitsentwicklung. Es entsteht Druck, und die Kenntnisse der Erstsprache(n) werden als unwichtig oder störend diskreditiert. Das Selbstbewusstsein der Schüler:innen sinkt, und sie empfinden ihre mitgebrachten sprachlichen Ressourcen als wertlos, obwohl eine Sozialisation in einer weiteren Sprache neben Deutsch einen erweiterten Blick auf die Welt ermöglicht. Die Wissenschaftlerin Nathalie Thomauske spricht hier von institutioneller Diskriminierung.
Französisch ja, Türkisch nein
Sprachen sind seit jeher eng mit Politik verbunden. Je akzeptierter eine Sprecher:innengruppe in der Gesellschaft gerade ist, desto prestigereicher ist auch ihre Sprache. Während bei Schüler:innen Erstsprachen wie Englisch oder Französisch als wertvoll und nützlich angesehen werden, gilt die Kenntnis von beispielsweise Türkisch oder Serbisch als Hürde für den guten Erwerb des Deutschen.
Kinder können das Prestige "ihrer" Sprachen schon sehr früh einschätzen. Sie sind dementsprechend entweder stolz auf ihre Mehrsprachigkeit oder schämen sich für sie. Doch die Abwertung von Sprachen ist immer auch eine Abwertung der Sprecher:innen. Mit Blick auf die im Moment medial sehr präsente politische Forderung nach Kinderrechten sollten wir nicht vergessen, dass die UN-Konvention der Kinderrechte genau dies fordert, dass nämlich jedes Kind das Recht hat, seine eigene Sprache, Kultur und Religion zu leben und dafür nicht diskriminiert zu werden.
Die Wissenschafterin Annedore Prengel weist darauf hin, dass in den 1980er-Jahren die Bildungssituation von Kindern mit Migrationshintergrund in hohem Maße vom Arbeitsmarkt, dem Wohnmarkt und von der Finanzpolitik bestimmt war. Dieser Umstand hat sich traurigerweise seitdem nicht verändert.
Es braucht keine Deutschgebote, sondern mehr personelle Ressourcen in der Schule, um Lehrer:innen zu entlasten und zu unterstützen, sowie monetäre Ressourcen, um sie auszubilden und um ihnen die Möglichkeit zu geben, jene Rahmenbedingungen zu schaffen, unter denen Kinder gut lernen können, dabei integrativ und nicht segregierend in Deutschförderklassen zu arbeiten.
Eine Sprache stärkt die andere
Was die Politik gerne übersieht und Sprachwissenschafter:innen schon lange wissen: Der Gebrauch einer weiteren Sprache neben Deutsch steht dem guten Deutscherwerb nicht im Weg. Es ist kein Entweder-oder, sondern ein Sowohl-als-auch. Gute Kenntnisse in einer Sprache fördern den Erwerb der anderen. Kinder lernen Sprachen intuitiv und kreativ. Je mehr Wissen und Inhalte sie in einer Sprache haben, umso schneller meistern sie eine weitere. Sie lernen nicht besser Deutsch, wenn man ihnen den Gebrauch der anderen Sprache verbietet, sondern wenn man Möglichkeiten schafft, damit der Gebrauch des Deutschen zielführend stattfinden kann. Dies gelingt mit guten Rahmenbedingungen und Wertschätzung und nicht durch Abwertung und Verbot der Erstsprache(n).
In diesem Sinne förderlich ist, wenn Kinder die Möglichkeit haben, ihre in den Unterricht mitgebrachten Sprachkenntnisse zu nutzen: sei es im Unterricht, um Inhalte für sich selbst besser einzuordnen, oder in der Pause, um mit anderen mehrsprachigen Kindern in Austausch zu treten. Sie fühlen sich dadurch wohler, und der Erwerb des Deutschen fällt leichter.
Mehrsprachigkeit als Ressource am Arbeitsmarkt
Durch den Gebrauch mehrerer Sprachen sind Kinder nicht nur offener für andere Kulturen, sondern auch kognitiv flexibler – und sie zeigen bessere kommunikative Fähigkeiten. In der heutigen vernetzten und globalen Welt wird die Kommunikation in verschiedenen Sprachen bekanntermaßen immer wichtiger. Durch Mehrsprachigkeit und die dazugehörige Kulturkompetenz kann hier wertvoller Austausch entstehen, der Vorteile für den Einzelnen und für unsere gesamte Gesellschaft hat.
Und damit das mehrsprachige Kind in all seinen Sprachen, auch im Deutschen, ankommen kann, braucht es erwachsene Bezugspersonen, die ihm die Freude an all diesen Sprachen vermitteln!
Tina Cakara hat Translationswissenschaften studiert. Sie war viele Jahre Mitarbeiterin im Beratungszentrum Linguamulti und ist derzeit im Bildungsbereich als Projektkoordinatorin tätig. Sie ist zweisprachig mit Kroatisch und Deutsch aufgewachsen und spricht darüber hinaus Englisch, Französisch und Italienisch.
Zwetelina Ortega ist Sprachwissenschafterin, Autorin, Expertin für Mehrsprachigkeit und Gründerin des Beratungszentrums Linguamulti. Dort bietet sie Beratung, Weiterbildungen und Projektkoordination für Mehrsprachigkeit und Sprachförderung an, in den Bereichen Bildung, Erziehung und Unternehmertum. Sie ist Gründerin der LIMU-Academy, des Sprachinstituts zur Frühförderung der deutschen Sprache für Kinder zwischen zwei und zehn Jahren. Ortega ist dreisprachig mit Bulgarisch, Spanisch und Deutsch aufgewachsen. In diesen drei Sprachen verfasst sie auch ihre literarischen Texte (2022 das Kinderbuch "Die Umami Bande", Amiguitos Verlag, 2012 den Gedichtband "Aз und tú", Edition Yara). Sie leitet Fortbildungen und lehrt unter anderem an diversen Pädagogischen Hochschulen in Österreich und Deutschland und lehrte an der Universität Wien.


